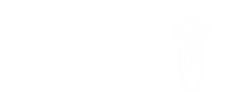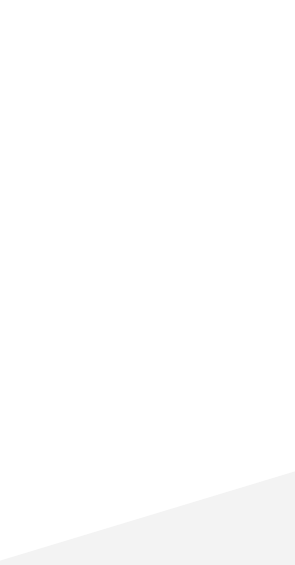Liturgisches Jahrbuch 3/2016
 Inhalt der Ausgabe 3/2016
Inhalt der Ausgabe 3/2016
Editorial
ZU DIESEM HEFT
Ulrich Ruh
Ein Fremdkörper? Christlicher Gottesdienst in einer säkularen Gesellschaft
Stefan Kopp
»… besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung …«. Zu einer »Reform der Reform« der Priesterweihe nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
Bogusław Migut
Auf der Suche nach einer Synthese in der Theologie. Die »Liturgische Theologie« der »Römischen Schule«
Jens Brückner
Erste Untersuchungen des Liber Ordinarius der Stiftskirche St. Gertrud in Nivelles. Bericht über einen Expertenworkshop vom 7. bis 8. März 2016 in Cambridge M. A.
Buchbesprechungen
Büchereinlauf
Editorial 3/2016: ZU DIESEM HEFT
Als im Juli 2016 die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte, dass im vergangenen Jahr 181.925 Katholiken aus der Kirche ausgetreten seien (immerhin so viele, wie im Jahr 2010, als flächendeckend Fälle von sexuellem Missbrauch durch Kirchenmitarbeiter bekannt geworden waren), attestierte der Freiburger Religionssoziologe Michael Ebertz Katholiken wie Protestanten ein massives Nachwuchsproblem. So sparten sich 90 Prozent der Katholiken die Sonntagsmesse und der Gottesdienstbesuch der Jugendlichen und jungen Erwachsenen tendiere gegen Null.
Eine Ursache sah Ebertz in der Form der Gottesdienste. »Es gibt eine regelrechte Schere zwischen kirchlichen Riten, die allein das Transzendente im Blick haben, und denjenigen kirchlichen Vollzügen, die relevante Bezüge des Lebens mit Transzendenz verbinden«, so der Religionssoziologe. Während Taufen, Hochzeiten, Erstkommunionfeiern und Beerdigungen nach wie vor Zustimmung fänden, verliere gerade die Messfeier, theologisch Höhepunkt und Quelle des kirchlichen Lebens, »dramatisch an Boden.«1
Zu durchaus vergleichbaren Beobachtungen kommt auch Dr. Ulrich Ruh in diesem Heft. Den ehemaligen Chefredakteur der »Herder-Korrespondenz« hatte die Schriftleitung gebeten, aus seiner Sicht die Situation des katholischen Gottesdienstes vor dem Horizont der heutigen, pluralen Gesellschaft mit ihrem säkularen Potential zu beschreiben. Es war dabei nicht an einen streng wissenschaftlichen Beitrag gedacht, vielmehr sollte der Theologe und Publizist essayhaft aus seiner Sicht Beobachtungen zur gegenwärtigen Situation des Gottesdienstes beisteuern. Ruh nimmt denn auch eine kritische Analyse der beiden großen christlichen Kirchen in unserem Land und ihrer Liturgie, speziell des Sonntagsgottesdienstes vor. Er benennt eine Reihe von Problemen und Spannungen. So sieht Ruh selbst motivierte und engagierte katholische Gläubige von der Abfolge von Texten und Riten einer nach der liturgischen Ordnung des deutschen Messbuchs gefeierten Sonntagsmesse überfordert; um wie viel mehr müsse dies für Menschen gelten, die ohne eine religiöse Sozialisation in eine Sonntagsmesse geraten, wie sie landläufig in vielen katholischen Kirchen zu beobachten ist. Darüber hinaus hat der Gottesdienst einerseits seine selbstverständliche soziale Verortung und Funktion auf weite Strecken eingebüßt, andererseits ist er aber fast das einzig sichtbare Feld, auf dem unmissverständlich der christliche Glaube an den dreieinen Gott, das zentrale Glaubensmysterium von Tod und Auferstehung Jesu Christi und die Kirche als eine die soziale Dimension überschreitende Gemeinschaft der Getauften zur Sprache kommt und sinnenhaft-symbolische Gestalt annimmt. Zahlreiche Seitenblicke zu den evangelischen Landeskirchen und der dort beobachtbaren Gottesdienstpraxis zeigen – bei allen konfessionellen Unterschieden im Einzelnen – manche Parallelen und Ähnlichkeiten auf.
Eine Konsequenz, die Ruh zieht: Es braucht eine größere Diversifizierung der gottesdienstlichen Formen. Neben der Vollform der Messfeier müssten vermehrt weitere Formen von Gottesdiensten treten, gerade auch solche, die einzelne Grundvollzüge gottesdienstlichen Feierns betonen und in den Mittelpunkt stellen (Musik, Verkündigung, Stille, Fürbitte, Segen). Man denke etwa an die vielfältigen pastoralen Erfahrungen mit den Gottesdiensten und rituellen Feiern des sogenannten »2. Programms«, die es wert wären, gesichtet zu werden, um nach möglichen liturgiepastoralen Perspektiven zu fragen.
Überdies reklamiert Ruh aber auch eine größere Sorgfalt in der Gestalt und Gestaltung der regulären Gottesdienste mit ihren in der Tradition der Kirche gründenden Texten und Riten. Allerdings müsse daneben auch eine qualitätsvolle Sprache der Gegenwart ihren berechtigten Platz haben. Letztlich muss deutlicher werden, was der Gottesdienst am Sonntag mit dem Leben der Christen im Alltag zu tun hat. Was vermissen Gläubige am Gottesdienst der Kirche? Wie können sie im Gottesdienst Kraft schöpfen, um unter der Woche als Christ oder Christin zu leben? Wie kommen Liturgie und Leben zusammen? Diese und ähnliche spannungsreiche Fragen wirft der Beitrag von Ulrich Ruh auf. Es wäre zu wünschen, er könnte zum Ausgangspunkt einer breiteren Diskussion werden.
Komplettiert wird das Heft mit einem Aufsatz des jüngst auf den Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Paderborn berufenen Prof. Dr. Stefan Kopp, der sich mit der »Reform der Reform« der Priesterweihe befasst und mit einem Beitrag des in Lublin lehrenden Liturgiewissenschaftlers Prof. Dr. Boguslaw Migut, der liturgietheologische Zugänge von drei Vertretern der »Römischen Schule« darstellt. Über ein Expertengespräch zum Liber Ordinarius der Stiftskirche St. Gertrud in Nivelles berichtet schließlich Jens Brückner (Tübingen).
1 Hier nach: kirchensite.de/aktuelles/kirche-heute/kirche-heute-news/datum/2016/07/17/religionssoziologe-fordert-lebensbezug-in-gottesdiensten/ (Zugriff: 19. Juli 2016).
[Anm. von liturgie.de: Dieser Internetauftritt ist seit 4. November 2016 unter anderer Adresse verfügbar]