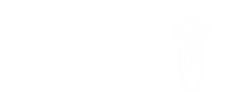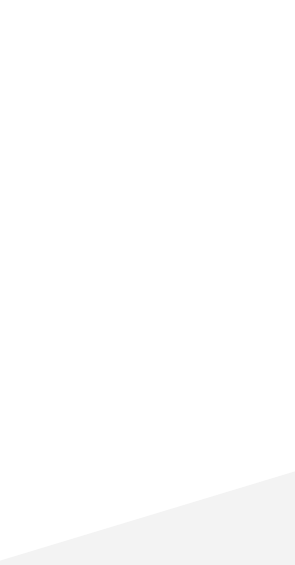Liturgisches Jahrbuch 2/2023
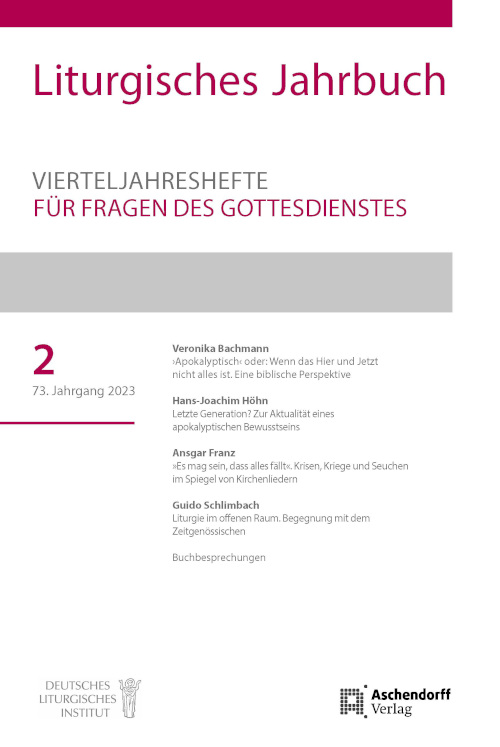 Inhalt der Ausgabe 2/2023
Inhalt der Ausgabe 2/2023
Editorial
Veronika Bachmann
Apokalyptisch‹ oder: Wenn das Hier und Jetzt nicht alles ist. Eine biblische Perspektive
Hans-Joachim Höhn
Letzte Generation? Zur Aktualität eines apokalyptischen Bewusstseins
Ansgar Franz
»Es mag sein, dass alles fällt«. Krisen, Kriege und Seuchen im Spiegel von Kirchenliedern
Guido Schlimbach
Liturgie im offenen Raum. Begegnung mit dem Zeitgenössischen
Buchbesprechungen
Editorial 2/2023: ZU DIESEM HEFT (Auszug)
Christus in rechter Weise zu erwarten, heißt nach Hölderlin, aufmerksam dafür zu sein, wo der „himmlische Triumphgang“, wie er für die Wiederkunft des Herrn zu erwarten ist, schon fragmentarisch beginnt. Die angemessene Reaktion auf entsprechende Erfahrungen ist, in den himmlischen Gesang einzustimmen, wenn dazu der göttliche Dirigent den Taktstock senkt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass dort, wo Christus endzeitlich präsent ist, „nichts […] gemein [ist]“, also Nichts mehr „alltäglich“: „Denn zum Alltag, zur Zeit, gehört unter anderem die gesprochene Rede, der Gesang ist stets Sinnbild des ewigen Zustandes, sei es inmitten der Zeit oder in ihrer Erfüllung am Ende“ (Wolfgang Binder)1: „Dieser Gesang weckt die Toten auf […,] ‚die noch gefangen nicht vom Rohen sind‘“, heißt es im weiteren Fortgang – gemäß Hölderlins Sprache diejenigen, die sich nicht fühllos dem Göttlichen entziehen oder sich ihm maßlos widersetzen.
Die Beiträge dieses Heftes reflektieren in je eigener Weise auf diese Zusammenhänge: Veronika Bachmann arbeitet aus bibelwissenschaftlicher Sicht und vornehmlich anhand vorchristlicher Texte heraus, welche verschiedenen Formen „Apokalypsen“ und „Apokalyptik“ in biblischer Zeit annehmen konnten. So entsteht eine Vorstellungswelt, die auch das Christentum maßgeblich beeinflusst hat. Und Bachmann stellt die Frage, wo sich aus solchen Quellen heraus eine spezifisch christliche Symbolik bilden konnte und kann, die an deren „Hoffnungshorizont“ anknüpft: eine Symbolik, die – vor allem in ihrer liturgischen Realisierung – im besten Fall die Kraft hat, in zutiefst krisenhaften Zeiten „über den Horizont des Real-Faktischen hinauszuführen, einer wahrhaftigeren Realität entgegen. – Hans-Joachim Höhn prüft aus systematisch-theologischer Perspektive und in zeitdiagnostischem Interesse, welche Herausforderungen aktuelle Formen von Untergangsprophetie und Weltuntergangsvisionen darstellen, und wie gerade christliche Glaubenspraktiken, speziell Liturgien, im Umgang mit Ängsten – anstatt zur Verdrängung oder Beschwörung – zur Entmachtung von Angst beitragen können. Er favorisiert dafür u. a. Formen der Klage, die angstauslösende Mächte nicht verdrängen oder ihnen das Feld überlassen, sondern „ihren Bann zu brechen und zu verhindern [vermögen], dass [Angst] ihre Macht über Menschen ausüben kann. Die Kraft der Angstentmachtung ist ein entscheidendes Kriterium bei einer Sichtung, welche Formen der Angstbewältigung Glaube und Kirche anzubieten haben.“ – Die beiden weiteren Beiträge von Ansgar Franz zu entsprechenden Motiven in Kirchenliedern, die sich in aktuellen Gesangbüchern des deutschen Sprachraums finden, und von Guido Schlimbach zur Arbeit der Kunststation Sankt-Peter Köln v. a. während der Pandemie zeigen, dass Kirche und ihre Liturgien diese Kraft womöglich u. a. dann am besten entfalten können, wenn sie sich auf die offene Begegnung mit den Künsten einlassen. […]
1 Wolfgang Binder, Hölderlins Patmos-Hymne, in: Hölderlin-Jahrbuch 15, hg. v. Bernhard Bäschenstein/Alfred Kelletat, Tübingen 1967–1968, 92–127, 118.