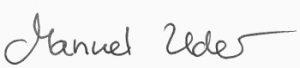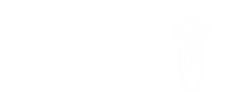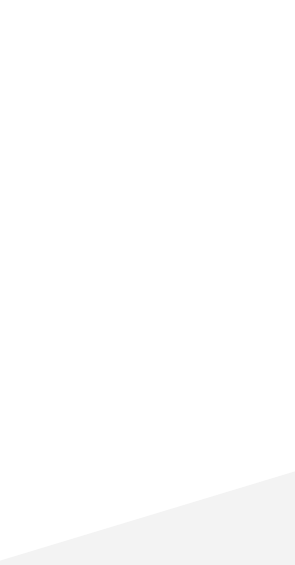Zeitschrift Gottesdienst
Ausgabe 11/2023
 Inhalt
Inhalt
- Leitartikel: Rettungsanker für die Gottesdienstpraxis? Taizé als Gesamterlebnis und seine Auswirkungen auf unsere heimischen Gottesdienste
- Segensfeiern für Paare. Liturgische Reformforderungen des Synodalen Wegs – Teil 2
- Mit Maria auf dem Weg. Eine geistliche Wanderung zu einer Kirche, einer Kapelle, einem Marienbild oder einem Wallfahrtsort
- Fürbittenvorschläge für den 11. bis 14. Sonntag im Jahreskreis (A)
- Liturgie aus Aktion – Aktion aus Liturgie? Dorothee Sölle und das Politische Nachtgebet
Editorial 11/2023
Liebe Leserinnen und Leser,
wer an Taizé-Gebete denkt, dem kommen zunächst die charakteristischen Gesänge mit ihren eingängigen Melodien in den Sinn. Deren Prinzip ist es, dass ein Grundgedanke aus wenigen Worten mehrfach wiederholt und damit schnell erfasst wird. Der Gesang mündet schließlich in eine Zeit der Stille, in der das Gesungene nachwirken kann. Wahrscheinlich ist es gerade diese Erfahrung, die Taizé anziehend macht: dass dem Schweigen Raum gegeben wird.
Von Zeiten der Stille kann jedwede Gottesdienstpraxis profitieren, z. B. im Fall der Fürbitten. Denn was vielen nicht immer bewusst ist: Es wird hier nicht nur ein Text abgelesen. Nein, Fürbitten sind Gebet, „Gebet der Gläubigen“!
Die Idee dahinter ist, dass man als feiernde Gemeinde für bestimmte Personen oder für bestimmte Personengruppen betet. Nach jedem Gebetsanliegen braucht es daher eine Zeit der Stille, damit die Genannten innerlich Form annehmen und die Mitfeiernden tatsächlich ins Beten kommen können. Erst nach ein paar Sekunden kann dann der Antwortruf aus vollem Herzen erfolgen.
Es braucht keine Stoppuhr für dieses gesammelte Schweigen. Wer wirklich verstanden hat, was Fürbitten sind, spürt, wie lange diese Zeit dauern muss. Es ist vielleicht das Wichtigste, was wir von Taizé lernen können: still zu werden und auf diese Weise zu lernen, was es heißt, zu beten: Mit Gott ins Gespräch kommen.
Ihr