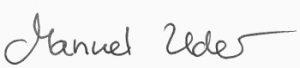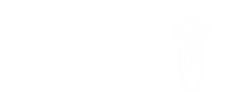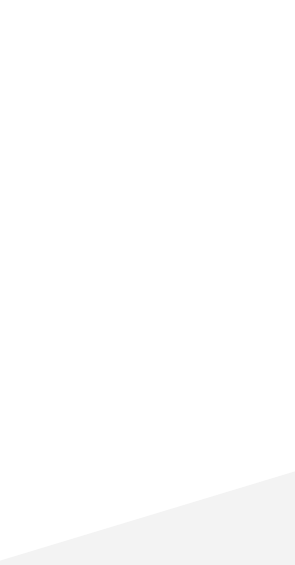Zeitschrift Gottesdienst
Ausgabe 5/2023
 Inhalt
Inhalt
- Leitartikel: Aus dem Geist einer christozentrischen Liturgie. Johannes van Acken und das St.-Elisabeth-Krankenhaus zu Köln-Hohenlind
- Sich als Geschwister im Gebet erkennen. Wie eine Ökumenische Vesper im Kloster Einsiedeln Konfessionen verbindet
- Fürbittenvorschläge für den Gründonnerstag bis Ostern – In der Nacht (A)
- Einführungen zu den Schriftlesungen: Ostermontag bis 6. Sonntag der Osterzeit (A)
- Robert Trottmann †
Editorial 5/2023
Liebe Leserinnen und Leser,
der im Leitartikel vorgestellte Sakralraum in Köln-Hohenlind steht stellvertretend für viele Kirchengebäude, die in den 1920er- und 1930er-Jahren entstanden sind. Ihre Konzeption ist christozentrisch geprägt: Der (Hoch-)Altar als Symbol Christi ist durch architektonische Hervorhebung weithin sichtbarer Mittelpunkt des Raumverständnisses.
Trotzdem gibt es einen großen Nachteil: Der Altar wirkt auf seltsame Art und Weise entrückt; das Gottesvolk erfährt Christus stark als Gegenüber. Im Laufe der Liturgiereform empfand man diesen Gegensatz als inakzeptabel und versuchte, mit der Errichtung eines neuen Volksaltars Liturgie und Gemeinde näher zusammenzubringen. Auch dieser Prozess steht exemplarisch für den Umgang mit vielen historischen Kirchengebäuden.
Heute würde man Gottesdiensträume anders konzipieren: Wer den Raum betritt, sollte im Idealfall den Eindruck gewinnen, dass man sich im Feierraum einer Gemeinschaft befindet. Er muss liturgischer Aktionsraum sein und daraufhin seine Gestalt gewinnen. Zudem muss er sinnenhafte Erfahrungen ermöglichen und offen sein für zeitgenössische Kunst. Zugegeben: Wenn man bereits diese wenigen Punkte beherzigt, wird man zu keinem optimalen, für alle Zeiten gültigen Raummodell kommen.
Doch das muss überhaupt nicht das Ziel sein. Es reicht aus, wenn ein Gottesdienstraum ein „Raum im Werden“ bleibt, der offen ist für Entwicklungen aus Kirche, Kultur und Gesellschaft.
Ihr