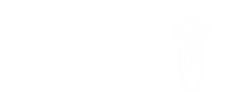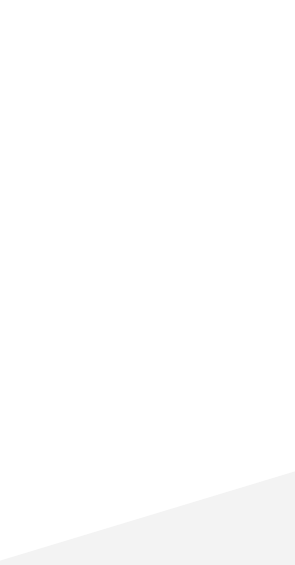Geschichte des Gesangbuchs
im deutschen Sprachraum
Gesang- und Gebetbücher haben im deutschen Sprachraum eine lange Tradition, die mit der Reformation begann. Um der reformatorischen Bewegung, die durch deutsche Gesänge und Lieder viele Menschen anzog, entgegenzuwirken, ließ der Haller Dominikaner und Propst Michael Vehe 1537 ein katholisches Gesangbuch drucken. Eine größere Bedeutung erfuhr aber erst das Gesangbuch des Bautzener Stiftsdekans Johann Leisentrit von 1567, das vielen späteren Gesangbüchern als Quelle und Vorbild diente. Zwar legte das Konzil von Trient (1545–1563) für die Messfeier weiterhin die lateinische Sprache fest, doch wurden alsbald auch deutsche Kirchenlieder als Begleitung des Gottesdienstes Brauch.
Der Jesuitenorden war es schließlich, der zur Förderung der Glaubensunterweisung in der Gegenreformation zahlreiche Gesangbücher herausgab, denen in der Barockzeit „typisch katholische“ Bücher mit vielen Fronleichnams-, Marien- und Heiligenliedern folgten. Einer der bedeutendsten Kirchenlieddichter jener Zeit war der Jesuit und Vorkämpfer gegen die Hexenprozesse Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635).
Nachdem es zunächst katholische Verleger gewesen waren, die Gesangbücher in großer Vielfalt herausbrachten, erschienen seit Beginn des 17. Jahrhunderts mehr und mehr Liedbücher, die von den Bischöfen für ihre jeweilige Diözese autorisiert waren. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden viele neue volkssprachliche Kirchenlieder, die sich auch in einer Fülle von Gebetbüchern niederschlugen. Deutsche Lieder setzten sich als Begleitung zur lateinischen Messe durch.
Die große Zeit der vom jeweiligen Ortsbischof genehmigten und vorgeschriebenen Gesangbücher brach indes erst im 19. Jahrhundert an. „Sie stärkten den Zusammenhalt der Ortskirchen und förderten einheitliche diözesane Gesangs- und Gebetstraditionen“, erläutert Prof. Andreas Heinz, Trier. In dieser Zeit tauchte auch die Idee eines Einheitsgesangbuches auf, mit einem Stamm von Kirchenliedern, die von allen deutschsprachigen Katholiken gemeinsam gesungen werden konnten. Es wurden zwar in der Folgezeit Einheitslieder in die Diözesangesangbücher übernommen, doch scheiterte der Plan eines wirklichen Einheitsgesangbuches nach dem Zweiten Weltkrieg noch, weil die meisten Bistümer ihre eigenen Gesangbücher nicht aufgeben wollten. Erst 1963, nach dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils, fassten die deutschen Bischöfe den Beschluss, ein gemeinsames Gesang- und Gebetbuch für alle deutschen Diözesen erarbeiten zu lassen, ein Projekt, dem sich 1966 Österreich anschloss. Das Ergebnis war das bis 2012 allenthalben im Gebrauch befindliche Gotteslob von 1975, welches, so Liturgiewissenschaftler Heinz, „überdiözesane Einheit mit regionaler Vielfalt“ verbinde. 2012 erschien sein Nachfolger und heißt weiterhin Gotteslob.