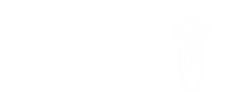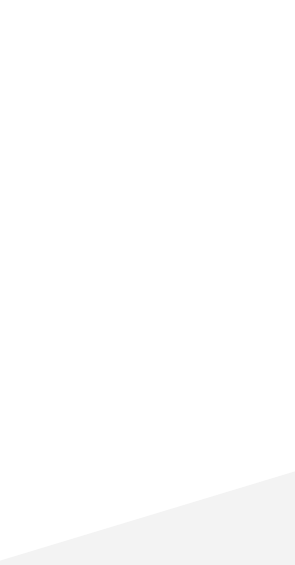»Gott loben in der Stille«
(GL 399)
Worte von Günter Balders 1984; Melodie von Hugo Nyberg 1903
Liedportrait von Meinrad Walter
Die Geschichte dieses Liedes beginnt keineswegs in der Stille, sondern auf einem Flohmarkt! Dort erstand Günter Balders (geb. 1942), Kirchengeschichtler und Hymnologe aus dem freikirchlichen Bereich, ein holländisches Liederbuch von 1935. Eine Melodie daraus hat ihn besonders fasziniert.
Die neuen Worte von Günter Balders sind ebenso schlicht wie die Melodie von Huugo Nyberg, die er in der interkonfessionellen Anthologie „Geestelijee Liederen us dem Schatz der Kirche von Jahrhunderten“ entdeckt hat. Miteinander verwandte Themen werden wie Gesten in den Klangraum gestellt: „Gott loben“, „Gott lieben“, „Gott leben“. Kein „Ich will aber“ oder „Wir sollen doch“ drängt sich vor. In fast mystischer Art verbinden sich Passivität und Aktivität. Die erste Strophe erinnert an das Gebet des Schweigens, denn jedes Beten gründet im Hören. Die These ist zudem kühn: Alles Schweigen „zu jeder Zeit“ kann zum Beten werden, indem es vom leeren Nicht-Reden zum erfüllten Schweigen wird. Das „Lieben“ in Strophe 2 ist grenzenlos, gleichsam verankert in ihm, der die Liebe ist (1 Joh 4,16) und aus Liebe seinen Sohn Jesus Christus nicht nur damals gesandt hat, sondern ihn heute „uns zur Seite gibt“.
Auf die Themen Gebet und Liebe folgt der Aspekt der Nachfolge mit der Kurzformel „Gott leben“. Alte Gebete wie „Jesus, dir leb ich, Jesus, dir sterb ich“ (vgl. Röm 14,8 und GL 367) klingen an. Auch das Nachfolgen beginnt nicht vordergründig aktiv, sondern mit einem „Staunen“, das ins Tun mündet. Die letzte Strophe fasst alle Impulse poetisch-theologisch zusammen. Und selbst darin steckt eine verborgene Aussage. Es geht nicht nur um die Abwechslung von Loben, Lieben und Leben. Es geht um die gegenseitige Durchdringung dieser drei Aspekte, die nun vom „Loben in der Stille“ poetisch gerahmt werden.
Die Stille ist das Thema. Wie aber komponiert man Stille? Durch Pausen vielleicht. Der Avantgarde-Komponist John Cage hat ein viel diskutiertes »stilles Stück« kreiert. In drei musikalischen Sätzen erklingt vier Minuten und 33 Sekunden lang – der Titel heißt „4‘33‘‘“ – kein einziger Ton. Ob solches Schweigen eine Form des Gotteslobs sein kann, muss wohl jeder selbst entscheiden. John Cage hätte es bejaht.
Die Musik von Huugo Nyberg (1873–1935) geht einen anderen Weg. Aus der Tiefe kommend, schwingt sie sich in zwei Anläufen hoch hinauf, um dann in die Stille einzumünden. Bogenförmig rundet sich die Melodie der ersten Zeile, vom Grundton h über den Weg einer Quart, bis am Ende wieder der Grundton erreicht ist. Die zweite Zeile bringt als Aufschwung einen Quartsprung sowie als melodische Abrundung eine Art Öffnung auf der Quint. Die dritte Zeile setzt eine Oktave höher ein als die erste. Markant erklingt die Tonwiederholung auf dem hohen d‘‘. Der hier erstmals erklingende Leitton ais festigt die Tonart kaum, sondern lässt sie in der Schwebe. Erst die letzte Zeile verknüpft die ruhigen Momente der zweiten und der ersten zu einer bogenförmigen Melodie, die von der Quint schrittweise absteigend in den Grundton mündet und so die Stille findet.
In der besonderen, ja kostbaren Zeit der Stille öffnet sich ein Fenster zur Ewigkeit. Nicht von uns draußen wird es geöffnet, sondern von innen. Wir können darauf aufmerksam sein, indem wir uns nicht an die Zeit verlieren, sondern der leisen Stimme Gottes Gehör schenken. Darauf weist je ein die Zeit gleichsam kontrapunktierendes Wort in jeder Strophe: „zu jeder Zeit“ (1), „ohne Ende“ (2) sowie „alle Tage“ und „immerfort“ (4).