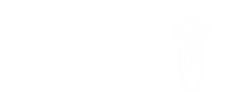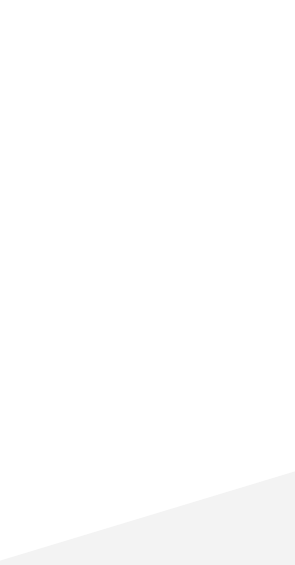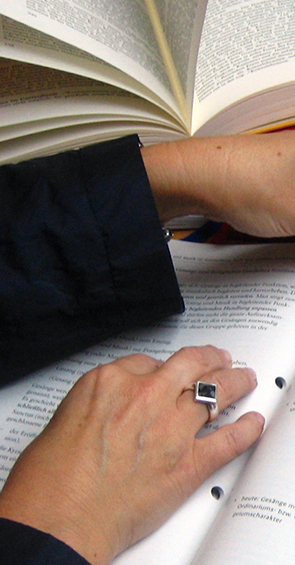
„Wir haben ausprobiert …“
Tagzeitenliturgien in der Gemeinde zu etablieren, ist mit Herausforderungen verbunden. Wie es gelingen kann, Hürden zu überwinden, zeigt das folgende Beispiel.
 Es ist Anfang Juni. Die Abendsonne fällt durch die farbigen Kirchenfenster auf die Statue des heiligen Bonifatius, dessen wir heute in unserem Abendlob gedenken. Eine Gemeinschaft von zwölf Mitfeiernden hat sich eingefunden; einige aus dem Dorf, einzelne aus Nachbarorten. Um 20 Uhr erheben wir uns und nehmen das Faltblatt zur Hand: „O Gott, komm mir zu Hilfe.“ Nach dem Hymnus setzen wir uns, um zuzuhören, und die Kantorin stimmt den Kehrvers des Psalms an. Dieser betrachtende Teil schließt mit dem Psalmgebet ab. Die Lektorin trägt am Ambo die Lesung vor. Dann Stille – wohltuend nach einem langen Tag und Raum für Gottes Wort. Auf die Verkündigung antworten wir vor Gott stehend mit dem Magnificat, dem Lobgesang Mariens. Die Kantorin beginnt, und wir singen die Verse im Wechsel. Die Lektorin liest die Gebetsanliegen der Fürbitten, und wir als Gemeinschaft tragen das Gebet durch unseren Fürbittruf. Der Gebetsteil mündet in das Vaterunser und die Oration vom Hochfest des heiligen Bonifatius. „Der Herr segne uns.“ Nach der Segensbitte schließt das Abendlob mit einem Bonifatiuslied.
Es ist Anfang Juni. Die Abendsonne fällt durch die farbigen Kirchenfenster auf die Statue des heiligen Bonifatius, dessen wir heute in unserem Abendlob gedenken. Eine Gemeinschaft von zwölf Mitfeiernden hat sich eingefunden; einige aus dem Dorf, einzelne aus Nachbarorten. Um 20 Uhr erheben wir uns und nehmen das Faltblatt zur Hand: „O Gott, komm mir zu Hilfe.“ Nach dem Hymnus setzen wir uns, um zuzuhören, und die Kantorin stimmt den Kehrvers des Psalms an. Dieser betrachtende Teil schließt mit dem Psalmgebet ab. Die Lektorin trägt am Ambo die Lesung vor. Dann Stille – wohltuend nach einem langen Tag und Raum für Gottes Wort. Auf die Verkündigung antworten wir vor Gott stehend mit dem Magnificat, dem Lobgesang Mariens. Die Kantorin beginnt, und wir singen die Verse im Wechsel. Die Lektorin liest die Gebetsanliegen der Fürbitten, und wir als Gemeinschaft tragen das Gebet durch unseren Fürbittruf. Der Gebetsteil mündet in das Vaterunser und die Oration vom Hochfest des heiligen Bonifatius. „Der Herr segne uns.“ Nach der Segensbitte schließt das Abendlob mit einem Bonifatiuslied.
Einige gehen nach dieser knappen halben Stunde des Gebets, andere setzen sich und lassen die Zeit nachklingen, bevor sie in den Abend und in den Alltag zurückkehren. Die Abendsonne ist nun weitergewandert und die Statue steht unauffällig auf ihrem Podest.
So oder ähnlich feiern wir monatlich in unserem Pfarrverbund gemeinsam Abendlob, das Tagzeitengebet als Liturgie der Gemeinde, und füllen unsere Kirchen mit Gebet und Gesang. Diese Gebetszeit hat sich in den vergangenen fünf Jahren langsam entwickelt. Wir haben ausprobiert, Erfahrungen gesammelt und immer wieder Veränderungen vorgenommen, wie nachfolgend beschrieben wird.
Im Sommer 2014 rief das Kirchenmusikinstitut des Bistums Fulda auf, im Rahmen der Kirchenmusiktage Anfang Oktober in den Gemeinden Tagzeitenliturgie, gesungenes Morgenlob und Abendlob, zu feiern. Dazu bot es zwei Vorlagen mit Auswahlelementen an. In dieser Sache wollte ich mich als Kantorin im liturgischen Dienst gerne engagieren und bekam Unterstützung durch Mitglieder des Liturgiekreises, die bereit waren, Dienste zu übernehmen, und vom Pfarrer, der zur Gestaltung des Gemeindezettels die mystagogischen Erschließungen, die aus dem „Bonner Mittagsgebet“ stammten, beisteuerte.
Der Ablauf des Abendlobs wurde vorbereitet, ein Gemeindezettel erstellt und die liturgischen Rollen aufgeteilt: Eine Lektorin verkündete die Lesung, eine Sprecherin las die Gebetsanliegen der Fürbitten, eine weitere die Erschließungen, und ich übernahm die Leitung und die responsoriale Gestaltung des Psalms. Auf eine Begleitung der Gesänge durch die Orgel oder andere Instrumente wurde bewusst verzichtet, um den Aufwand einzugrenzen. Die Gebetszeit wurde im Pfarrbrief, am Ende der Sonntagsmesse und auf Plakaten angekündigt.
So fanden sich an einem Donnerstagabend im Oktober knapp 30 Gemeindemitglieder in der kleinen Turmkapelle ein und beteten bei Kerzenlicht gemeinsam das Abendlob. Die Reaktionen waren positiv: eine halbe Stunde zum „Runterkommen“, die schöne Atmosphäre in der Kapelle, ansprechende Texte, nur der Psalm usw. Das alles war gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem entschieden wir: Das können wir wieder machen!
Es folgten weitere Tagzeitengebete, und bald wurde klar, dass dieses „Baukastensystem“ viele Möglichkeiten für die konkrete Ausgestaltung vor Ort bietet und damit gut auf die Feiergemeinde abzustimmen ist: Als Hymnus kann ein traditionelles Loblied verwendet werden, aber auch ein Neues Geistliches Lied; der Psalm ist responsorial, antiphonal, als Psalmlied oder als Taizé-Gesang gestaltbar; die Fürbitten können ein gemeinsames Gebet sein, Gebetsanliegen mit Fürbittruf oder ein Andachtsabschnitt aus dem „Gotteslob“; das Vaterunser kann in verschiedenen Fassungen gesungen oder gesprochen werden.
Jedes Abendlob wurde aus der Fülle der Materialien einzeln vorbereitet, und aus den Erfahrungen erwuchsen immer wieder organisatorische Veränderungen:
- Das Gebet findet nun einmal im Monat, oft montags, in einer Kirche des Pfarrverbundes statt. Termin und Ort werden auf der Homepage, im Pfarrbrief und im Aushang veröffentlicht.
- Die Erläuterungen werden nur gelegentlich abgedruckt und nicht mehr laut gelesen, um wiederholt Mitbetende nicht zu langweilen.
- Eine zweite Kantorin kommt dazu, sodass wir den Psalm und andere Gesänge gut im Wechsel singen können, da die Gemeinde immer von einer sicheren Sängerin gestützt wird.
- An einzelnen Terminen ist es möglich, dass ein Organist den Gesang begleitet oder auch eine Gruppe mit Flöte, Gitarre und Klavier.
- Zeichenhandlungen wie Luzernar, Weihrauchspende, Prozession oder Taufgedächtnis werden gelegentlich in die Liturgie eingefügt.
Trotz dieser erfreulichen Entwicklung blieben offene Fragen: Wie kann die Vorbereitung vereinfacht werden? Wie können die Erklärungen zu den einzelnen Elementen für alle zugänglich, aber nicht aufdringlich eingebracht werden? Mit welchen Hilfen kann den Mitfeiernden ohne Vorerfahrung ermöglicht werden, aktiv teilzunehmen? Antworten auf diese Fragen bieten die Materialien vom Verein „Ökumenisches Stundengebet“ (www.oekumenisches-stundengebet.de), der sich für die Förderung von Stundengebetsinitiativen in Gemeinden einsetzt. Auf einem Studienwochenende von LITURGIE IM FERNKURS im Februar 2019 wurden diese vorgestellt. Zudem bietet der entsprechende Lehrbrief von LITURGIE IM FERNKURS fundiertes Hintergrundwissen zur Tagzeitenliturgie.
Das war Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, und Anregung, die oben beschriebenen „Stolpersteine“ anzupacken, damit die Gestaltung der Gebetszeit gut auf die jeweilige Situation abgestimmt wird.
Nun wurde ein wieder verwendbares Faltblatt erstellt, das außen die wichtigsten Informationen zur Organisation des Tagzeitengebets im Pfarrverbund und innen den klar strukturierten Ablauf mit den entsprechenden Erläuterungen bietet. Wiederkehrende Elemente – wie Eröffnung und Segensbitte – sind abgedruckt. In die Mitte kann zu jedem Abendlob neu ein schmales Blatt mit den Nummern der Materialien aus dem „Gotteslob“, das nun verstärkt verwendet wird, sowie mit Hinweisen zur Gebetshaltung und den Wechselgesängen eingelegt werden, sodass die Mitfeiernden zur aktiven Teilnahme am Tagzeitengebet angeregt werden.
Seit vier Monaten verwenden wir dieses System. Ob es sich bewährt, wird sich zeigen. Wir sind auf dem Weg, die Tagzeitenliturgie als „Basis-Liturgie des Volkes Gottes“ (Achim Budde) in die Gemeinden zu bringen. Damit die Menschen den Kontakt zu Gott pflegen und unsere Kirchen das sind, was sie sein sollen: Orte des gemeinschaftlichen Gebets.
Nicole Stöppler
Absolventin von LITURGIE IM FERNKURS Einstieg 04/18
Quelle: Gottesdienst. Die Zeitschrift der Liturgischen Institute Deutschlands, Österreichs und der Schweiz 53, 2019, Heft 16, S. 186–187
DOWNLOAD des Beitrags als PDF-Datei